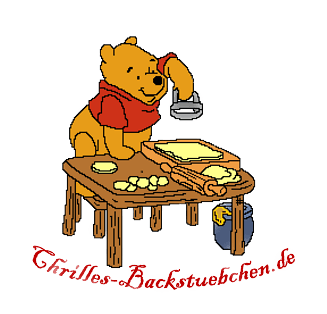Chrilles Backstübchen
Getreide, Mahlmühlen, Mehl und Brot sind so eng miteinander verwoben, daß auch bei geschichtlicher Betrachtung das eine kaum vom anderen zu trennen ist.
Wie und wann alles anfing ? Viele Tausend Jahre Menschheitsgeschichte waren bereits vergangen, ehe man Brotgetreide in seiner heutigen Form züchten konnte, beginnend mit Grassamen, nachdem unsere Vorfahren etwa gegen Ende der mittleren Steinzeit entdeckt hatten, daß aus Samen neue Pflanzen entstanden. Damals hatten sich nomadisierende Jäger und Hirtenvölker seßhaft gemacht und begannen mit dem Ackerbau; sie lernten zu säen und zu ernten. Dieser Wandel vollzog sich in langen Zeiträumen und begann vor etwa 6000 Jahren in klimatisch begünstigten Gebieten, wie in Mesopotamien zwischen Euphrat und Tigris. Aus dieser Zeit schon sind die ältesten Getreidepflanzen als Kulturform bekannt: Emmer, Weizen Gerste und Hirse. In den nächsten 3000 Jahren breiteten sich diese Getreidearten im gesamten Orient, in Ägypten, China und Indien aus. Um 2000 vor Chr. tauchte Getreide in Mitteleuropa auf.
Mit Reibsteinen, Mörsern und Reibmühlen rückte man den Körnern zu leibe und verarbeitete sie so zu einer Art Schrot. Mit diesen primitiven Mitteln war zwar noch kein Mehl, wie wir es heute kennen, zu gewinnen. Doch das Getreidekorn wurde immerhin schon gebrochen. Daraus wurde mit Wasser oder Milch und Fett ein Brei gerührt. (Der übrigens noch heute für fast 50 % der Weltbevölkerung Grundbestandteil der täglichen Kost ist), und wurde auf erhitzten Steinen zu kleinen, rundlichen Fladen gebacken oder inn die heiße Asche geschoben. Durch Ausgrabungsfunde in Bulgarienweiß man, daß um 3000 vor Chr. schon Backöfen bekannt waren, und die dabei verwendete Backkeramik deutet darauf hin, daß sie ihren Ursprung im Orient hatten. Auch sogenannte Röhrenöfen benutzte man. Sie wurden von innen beheizt und die Teigfladen von außen darauf geklebt. In Indien machte man es sich einfach, indem man die Fladen an die von der Sonne aufgeheizten Lehmhüttenwände festmachte.
Solche Fladen mußten warm verzehrt werden, denn sie wurden nach dem Erkalten steinhart. Dann waren sie ideal als "Reiseproviant" für die bronzezeitlichen Jäger etwa um 2000 v.Chr. und später für die Wickinger, denn sie hatten einen geringeren Wassergehalt und konnten nicht verderben. Durch Einweichen in Milch oder Wasser ließ sich dann dieses "Brot", das natürlich mit dem heute uns bekannten Brot nicht zu vergleichen ist, wieder in einen Brei zurückverwandeln.
Reibsteine, auf denen die Getreidekörner zwischen zwei Steinen zerrieben wurden, waren also die ersten Vorläufer der heutigen Mühlen, Mörsersteine dienten zum Zerkleinern weicher Getreidekörner, wie z.B. Hirse. In einem ausgehöhlten Stein zerstampfte man Körner mit einem keulenartigen Stück Hartholz. Diese Arbeiten wurden zumeist von Frauen oder Kindern ausgeführt.
Um etwa 1800 v.Chr. muß dann irgendjemand beim anrühren des Getreidebreies eingeschlafen sein. Der Brei blieb länger stehen, wurde durch Gärung aufgeweicht und siehe da, es ergab sich auch ein lockeres Gebäck. Damit war der Vorläufer unseren heutigen Brotes erfunden. Diese "Entdeckung" wird den Ägyptern zugesprochen. Sie bauten fortan neben ihren Häusern feste Backöfen aus Lehm oder formten etwa drei Meter hohe "Backtöpfe" aus Stein.
Nach dieser Grundlegenden Entdeckung ging es dann Schlag auf Schlag voran. Die "Nachfrage" nach solchen Brot wuchs. Erfindergeist wurde angeregt; erste drehbare Getreidemühlen entstanden, und um 300 v.Chr. erfand man den Mahlstein in ähnlicher Form, wie wir ihn heute noch kennen. Über einen festliegenden Unterstein wurde ein gleich großer drehbarer Läuferstein gelegt, der um eine Achse, die in der Mitte des Untersteins befestigt war, drehbar gehalten wurde.
Vor etwa 1950 Jahren wurde in Rom ein Produkt hergestellt, das man schon als Mehl bezeichnen konnte. Die zerkleinerten Getreidekörper wurden über gekochte Tierhäute, Leinfaser- oder Pferdehaarsiebe geschüttet und darauf hin und herbewegt. So trennten sich Mehlkörper und Schale, und man gewann also "Mehl". Im Laufe der nächsten 200 Jahre entwickelten sich handwerkliche Bäckereien; um 400 n. Chr. soll es in Rom bereits mehr als 250 Bäckereien gegeben haben, die zum Teil schon als Großbetriebe mit täglicher Verarbeitung von bis zu 30 Tonnen Getreidemahlerzeugnisse geführt wurden.
In den folgenden Jahrhunderten beginnt in Nord- und Mitteleuropa die allmähliche Verdrängung von Brei und Fladen durch gelockertes Brot. Dem voraus ging jeweils die Weiterentwicklung der für das Mehlmahlen zuständigen Mühlen. Jeder von uns kennt Bilder von sogenannten Tretmühlen, bei denen Sklaven oder verurteilte Verbrecher im Innern großer Röhnrad ähnlicher Räder durch Treten die Mechanik in Bewegung halten mußten. Esel und Pferde wurden eingespannt, um Göpelmühlen anzutreiben. Wassermühlen kannte man allerdings im Orient schon um 200 Jahre vor Chr.. Marcus Vitruvius Pollino, der um Christi Geburt lebte, lieferte eine ausführliche Beschreibung einer Wassermühle, die schon mit Waagerechter Welle und Zahnrad- Winkelgetriebe ausgestattet war- Eine geniale Idee der Kraftübertragung aus jener Zeit, die bis heute fortwirkt. Nach diesem Prinzip wurden noch bis zum 19. Jahrhundert Wasser- und Kornmühlen gebaut. So wurde die Wasserkraft auch zum Antrieb von Sägemehl, Eisenhämmern oder Wasserschöpfanlagen genutzt. Die Windmühlen sind dagegen erstaunlich "jung". In Westeuropa kennt man sie erst seit etwa 1200. In den Niederlanden, das als mühlenreichstes Land Europas gilt, fand man sie erst 100 Jahre später; vornehmlich wurden sie hier allerdings als Schöpfwerke für Entwässerungsarbeiten genutzt.
Im Laufe der Geschichte und mit dem rascheren Ansteigen der Bevölkerungszahlen entwickelten sich Mehl und Brot zu einem Grundnahrungsmittel. Da die Verfügbarkeit hierüber MAcht darstellte, wurde sie auch zur Machtausübung benutzt. So nahmen sich die Herrschenden, die Inhaber der Gerichtsbarkeit, die Landesherren, das Vorrecht, über den Bau von Mühlen zu bestimmen. Kaiser Karl der Große verlangte an jedem Königshof einen Müller, der gutes weißes Mehl herzustellen verstehe. So wurden Herrschaftsmühlen aus Mittel der Landesherrschaft erbaut. Später wurden sie für einen gewissen Zeitraum als Pachtmühlen oder auch auf Lebenszeit dem Müller gegeben. In späteren Jahren findet man dann die Vergabe von Mühlen in Erbpacht; nicht nur der jeweilige Pächter, sondern auch seine Nachkommen werden dort Müller. Um ein solches Pachtrecht zu erwerben, mußte zunächst eine bestimmte Summe und anschließend die jährliche Erbpacht in Naturalien oder in Bargeld bezahlt werden.
In den verschiedenen Herrschaftsgebieten gab es unterschiedliche Regelungen, z.B. die Bann- und Zwangsmühlen, die die Bauern zwangen, in bestimmen Mühlen ihr Getreide mahlen zu lassen. Sodann vergaben die Herrschenden unterschiedliche Rechte, was die Vermahlung des Getreides betraf. Nicht alle Mühlen durften Getreide zu Mehl vermahlen. Viele Müller hatten nur das Recht, Roggen zu Schrot zu verarbeiten oder sie bedurften wieder einer besonderen Konzession für die Herstellung von Graupen oder Grütze. Für seine Arbeit erhielt der Müller zumeist kein Bargeld von seinen Kunden, , sondern die "Metze". Die Metze war etwa der 16. Teil des der Mühle abgelieferten Getreides oder auch ein geeichtes Gefäß aus Metall oder Holz. Hatte der Müller aber, z.B. im Gebiet preußischen Rechts, die Pacht verliehen bekommen, konnte er auf der ihm übertragenden Mühle nach eigenen Ermessen schalten und walten. Andererseits hatte er sämtliche Kosten der Instandhaltung zu tragen. So erwuchs den Müllern das Bewußtsein freien uns selbstverantwortlichen Handelns.
Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurden allmählich, nicht zuletzt durch das Eindringen der französischen Herrschaft, die angesammelten Rechte und Pflichten hinfällig. Wohl mußten auch den neuen Herrschern zur Weiterführung einer Mühle gewisse Mühlen bezahlt werden, doch eröffneten sich nun die Möglichkeiten als Folge der Gewerbefreiheit und der Freigabe der Mühlen aus der Gewerbeordnung, neue Mühlen zu errichten und zu betreiben.
Im 19. Jahrhundert entstanden die ersten "Dampfmühlen", Mühlen, die durch Dampf angetrieben werden. Die Mühlsteine wurden durch Mehlwalzen, zylinderförmige, horizental angeordnete gegenläufige Walzenpaare aus Metall, die zum Aufbrechen des Kornes mit Riffeln versehen wurden, abgelöst. Die Erfindung und Entwicklung eines solchen "Walzenstuhls" und großer Siebmaschinen waren bahnbrechend für die für die Müllerei und ermöglichten es, Mehl in großen Mengen wirtschaftlich zu produzieren. Die Motorisierung tat ein Übriges. Nach dem 1. Weltkrieg kam der Antrieb über Elektromotoren, die wieder über Transmissionen verschiedene Mahlgänge bedienen konnten. Sowohl Dampfbetrieb wie Elektrobetrieb machten die Mühlen unabhängig von Wind und Wasser. Eine solche Mühle zu errichten, erforderte jedoch hohen Kapitaleinsatz.
Stetige technische Weiterentwicklung der Müllereimaschinen bei gleichzeitigem Erfolg in der Züchtung hochwertigere Getreidesorten ermöglichten dem Müller, immer gleichmäßigere und hochwertigere Produkte und auf spezielle Verarbeitungsweisen abgestimmte Mehle herzustellen.
Die Mühle von heute und morgen ist ein hochtechnisiertes Gebilde, in dem der Produktionsablauf von der Getreideannahme über die Reinigung, die Vermahlung und Reinigung der Produkte zum großen Teil computergesteuert und automatisiert ist. Wenngleich die Produkte selbst mit Menschenhand nicht mehr in Berührung kommen, bleiben doch Ideenreichtum, fachliches Wissen und Können und gewissenhafte Überwachung aller Anlagen der in der Mühle beschäftigten Menschen, kurz die Müller, notwendig.