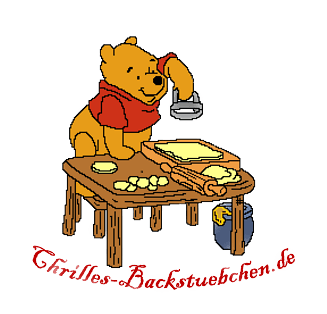Chrilles Backstübchen
Meister
Die über 1,5 Mio. erwerbstätigen Meister in der Bundesrepublik Deutschland haben ihre Meisterqualifikation auf unterschiedlichem Wege erlangt.
Die auf der Gesellen- / Facharbeiterausbildung aufbauende Qualifikation zum Handwerksmeister stellt dabei vom zahlenmäßigen Umfang und von der Funktion her die bedeutendste Gruppe dar.
Die Fortbildung zum Industriemeister bietet eine zweite wichtige Möglichkeit, auf der Grundlage des Facharbeiter- / Gesellenbriefes eine Meisterqualifikation zu erwerben. Weitere Qualifikationsmöglichkeiten gibt es in der Land- bzw. in der Hauswirtschaft sowie in anderen Wirtschaftsbereichen.
Als eine Sondergruppe unter den erwerbstätigen Meistern sind die Statusmeister anzusehen, die ihre Meisterqualifikation nicht durch den formalen Abschluß einer Meisterprüfung erworben haben, sondern entweder durch beruflichen Aufstieg in die Position eines Meisters gelangten oder sich aber aufgrund bestimmter Berufsbezeichnungen als Meister verstehen.
Die berufliche Arbeit von Meistern stellt sich als eine vielfältige, komplexe und anspruchsvolle Tätigkeit dar:
Meister leisten in hohem Maße Führungs- und Managementaufgaben, indem sie z.B. einen eigenen Betrieb führen, Mitarbeiter anleiten oder ausbilden, Arbeitsabläufe planen und organisieren sowie Beratungs- und Kontrollaufgaben übernehmen.
Es sind gerade die Führungs- und Managementtätigkeiten, die Meister von Facharbeitern unterscheiden.
Meister erweisen sich insgesamt als eine Berufsgruppe, die ihre erlernten Qualifikationen besonders gut verwerten kann:
Meister verdienen gut, sie können in der Regel sehr viel ihrer Lehr- und Meisterausbildung verwenden, sie sind zum Teil sehr zufrieden mit ihrer Tätigkeit wie auch mit ihrem Berufsleben insgesamt, sie weisen eine hohe Aufsteigerquote bei Berufswechsel auf, haben weniger Angst vor Entlassung und sind insgesamt seltener arbeitslos.
Ein noch günstigeres Bild der Qualifikationsverwertung zeichnet sich bei den selbständigen Meistern ab, die in allen Merkmalen beruflichen Erfolges Spitzenwerte aufweisen.
Die Möglichkeit, sich zum Meister eines bestimmten Handwerks ausbilden zu lassen, haben eine lange Tradition; die ältesten Hinweise auf Prüfungsbestimmungen für Handwerksmeister in Deutschland werden aus dem 14. Jahrhundert überliefert.
Die derzeit gültige Rechtsgrundlage der Meisterprüfung im Handwerk stellt die Handwerksordnung aus dem Jahre 1965 dar.
Hinsichtlich der Voraussetzung zur Meisterprüfung besagt die Handwerksordnung, daß diejenigen zugelassen werden, die eine Gesellen- bzw. Facharbeiterprüfung abgeschlossen haben und in dem Beruf, in dem sie die Prüfung ablegen wollen, über eine mindestens dreijährige Gesellentätigkeit verfügen.
Eine erfolgreich abgelegte Meisterprüfung im Handwerk berechtigt dazu, einen Handwerksbetrieb selbständig zu führen und Lehrlinge einzustellen und auszubilden.
Durch die Meisterprüfung ist festzustellen, ob ein Prüfling befähigt ist, einen Handwerksbetrieb selbständig zu führen und Lehrlinge ordnungsgemäß auszubilden. Insbesondere ist zu prüfen, ob ein Prüfling die in seinem Handwerk gebräuchlichen Arbeiten meisterhaft verrichten kann und die notwendigen Fachkenntnisse sowie die erforderlichen betriebswirtschaftlichen, kaufmännischen, rechtlichen und berufserzieherischen Kenntnisse besitzt.
Die Meisterprüfung im Handwerk wird durch staatliche Prüfungsbehörden abgenommen, die ihren Sitz bei der Handwerkskammer ihres Bezirkes haben.
Die Prüfungsanforderungen sind gesetzlich geregelt und in den Teilen I und II der Meisterprüfung von Beruf zu Beruf unterschiedlich. Die Teile III und IV sind dagegen für alle Berufe gleich. In der Regel ergeben sich folgende Anforderungen:
Teil IDie Prüfung der meisterhaften Verrichtung der im jeweiligen Handwerk gebräuchlichen Arbeiten
(Meisterarbeit und Arbeitsprobe) z.B.:
- Meisterprüfung: Herstellen eines Sortimentes Backwaren aus dem Bereich Brot und Kleingebäck, bestehend aus einer Spezialbrotsorte unter Verwendung von
Natursauerteig sowie aus speziellen Kleingebäcken aus mindestens zwei verschiedenen Teigen, eines Sortiments feiner Backwaren, bestehend aus einer Festtagstorte
sowie aus Desserts aus verschiedenen Massen unter Verwendung von Creme und Sahne.
- Arbeitsprobe: Herstellung eines Roggenmischbrotes unter Verwendung von Sauerteig sowie eines Weizenmischbrotes, Herstellung ortsüblicher Brötchensorten,
von Hefegebäck, insbesondere Plunder- oder Blätterteiggebäck, Verkaufsgerechtes Präsentieren und Dekorieren von Backwaren.
Teil II Die Prüfung der erforderlichen fachtheoretischen Kenntnisse im jeweiligen Handwerk
(Fachtheorie) z.B.:
- Fachrechnen,
-Fachtechnologie,
- Roh- und Hilfsstoffe,
- Kalkulation, Verkaufskunde und -förderung.
Teil IIIDie Prüfung der erforderlichen betriebswirtschaftlichen, kaufmännischen und rechtlichen Kenntnisse
Wirtschaftliche und rechtliche Grundlagen:
- Rechnungswesen:
Buchhaltung und Bilanz, Kostenrechnung, Betriebswirtschaftliche
Auswertung der Buchhaltung.
- Wirtschaftslehre:
Grundfragen der Betriebs- und Geschäftsgründung, Betriebs- und Arbeitsorganisation, Personalorganisation,
Betriebswirtschaftliche Aufgaben im Handwerksbetrieb, Finanzwirtschaftliche Grundfragen,
Gewerbeförderungsmaßnahmen.
- Grundzüge des Rechts- und Sozialwesens:
Bürgerliches Recht, Handwerksrecht, Arbeitsrecht, Sozial- und
Privatversicherungsrecht, Vermögensbildungsrecht, Steuerwesen.
Teil IVDie Prüfung der erforderlichen berufs- und arbeitspädagogische Kenntnisse
Berufs- und Arbeitspädagogik:
Grundfragen der Berufsbildung, Planung und Durchführung der Ausbildung, Der Jugendliche in der Ausbildung, Rechtsgrundlagen der Berufsbildung.
Elektronische Datenverarbeitung:
Vorteile des EDV-Einsatzes im Betrieb, Betriebliche Daten und ihre Verarbeitung, Hard- und Softwarekomponenten, Betriebssystem des PC,
Datenverarbeitungsorganisation, Entscheidungskriterien für die Auswahl eines PC.
#Unterrichtsform:#Vollzeit
#Gesamtdauer:#Ca. 4 Monate, 840 UStd.
#Unterrichtszeiten:#Montag - Freitag 08.00 - 17.00 Uhr
#Beginn der Veranstaltung:#Auf Anfrage
#Hinweise zu Terminen / Dauer:#Jährlich (Vollzeit), auf Anfrage (Teilzeit)
#Kosten/Gebühren:Lehrgangsgebühr:#z. Zt. DM 6.600,-/EUR 3.374,53 (Ratenzahlung möglich)
In einigen Bundesländern ermöglicht eine erfolgreich bestandene Meisterprüfung unter bestimmten Voraussetzungen den Zugang zu bestimmten Studiengängen an Hochschulen.
Stimmten Voraussetzungen den Zugang zu bestimmten Studiengängen an Hochschulen.